
Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Wärmewende beginnt vor Ort
Seit Anfang 2024 gilt in Deutschland ein neues Gesetz zur Wärmeplanung (WPG).
Alle Städte und Verbandsgemeinden müssen jetzt einen Plan erstellen, wie die Gebäude in ihrem Gemeindegebiet zukünftig klimafreundlich beheizt und mit Warmwasser versorgt werden können sollen. Auch die Bürger:innen sollen dabei mitreden können.
Die Kommunen erhalten vom Land Rheinland-Pfalz einen Mehrbelastungsausgleich für ihre Arbeit.
Wir helfen Kommunen dabei, ihre Wärmeplanung durchzuführen – Schritt für Schritt und gemeinsam mit den Menschen vor Ort.
Welchen Weg der Kommunalen Wärmeplanung geht Ihre Kommune?
*durch Klick auf Ihren Finanzierungsweg kommen Sie direkt zu den für Sie relevanten Dokumenten.
Das sind unsere Angebote für Kommunen

Beratung
Sie brauchen Unterstützung auf dem Weg zur kommunalen Wärmeplanung? Senden Sie uns Ihre Anfrage bitte per E-Mail. Unsere kostenfreie Beratung erfolgt dann via E-Mail, Telefon, Videokonferenz oder bei Ihnen vor Ort.

Praxishilfen
Wir stellen Ihnen hilfreiche Mustervorlagen für die Ausschreibung und Vergabe, eine Handreichung zum Muster-Leistungsverzeichnis sowie verschiedene Leitfäden z. b. zur Akteursbeteiligung zur Verfügung.

Vernetzung
Sie möchten mit anderen zum Thema diskutieren und sich austauschen? Dazu organisieren wir regelmäßig Netzwerktreffen für Mitarbeiter:innen von Kommunen und Klimaschutzmanager:innen.
Kommunale Wärmeplanung nach Wärmeplanungsgesetz
Wenn Ihre Kommune keinen Antrag auf Bundesförderung für die freiwillige Wärmeplanung beim ZUG gestellt hat (bis zum 04.12.2023) oder eine Ablehnung erhalten hat, sind Sie nun verpflichtet, eine Kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Das gilt laut Wärmeplanungsgesetz (WPG) und Landesgesetz (AGWPG).*
Wir helfen Ihnen dabei mit:
Beratung und Mustervorlagen für Ausschreibungen und Vergaben:
KWW-Musterleistungsverzeichnis zur Ausschreibung einer Kommunalen Wärmeplanung in Rheinland-Pfalz (pdf)KWW-Musterleistungsverzeichnis zur Ausschreibung einer Kommunalen Wärmeplanung in Rheinland-Pfalz (word)
- Leitfäden zur Beteiligung von Bürger:innen und anderen Akteuren
- Hinweisen zur Berechnung möglicher Ausgleichszahlungen (Konnexität)
- Tipps für eine klare Kommunikation mit der Bevölkerung
Empfehlungen der Energieagentur Rheinland-Pfalz für die Websites der Kommunen
Wer ist zuständig?
Laut AGWPG sind das die sogenannten planungsverantwortlichen Stellen – also:
- kreisfreie Städte
- große kreisangehörige Städte
- verbandsfreie Gemeinden
- Verbandsgemeinden
Mehrere planungsverantwortliche Stellen können für mehrere Gemeindegebiete eine gemeinsame Wärmeplanung durchführen.
*Sollte bei Ihnen ein mit Bundesmitteln gefördertes Klimaschutzteilkonzept „Wärmenutzung“ vorliegen (ggfs. auch nur für einen Teil Ihres heutigen Gemeindegebietes), kommen Sie gerne für ein individuelles Beratungsgespräch auf uns zu.
Nach dem Landesgesetz (Ausführungsgesetz für das Wärmeplanungsgesetz – AGWPG vom 17.04.2025) sind die kreisfreien und die großen kreisangehörigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden und die Verbandsgemeinden planungsverantwortliche Stellen. Diese führen die Wärmeplanung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung durch.
- Die „Akteursbeteiligung“ ist im § 7 des WPG geregelt. Es sind z. B. Energieversorgungs- und Wärmenetzbetreiber, Behörden, Großverbraucher, Energiegemeinschaften, Unternehmen und Verbände zu beteiligen.
- Auch die Beteiligung der Öffentlichkeit ist zwingend erforderlich, und wird durch Informationsveranstaltungen und Workshops, Online-Plattformen sowie Veröffentlichungen empfohlen.
- Lokale Akteure wie die Verwaltung, Unternehmen und die Bürgerschaft gezielt frühzeitig sowie kontinuierlich zu beteiligen, bringt viele Vorteile: Sie nutzen das Fachwissen vor Ort, berücksichtigen verschiedene Perspektiven, bündeln Kompetenzen und erhöhen das Verständnis sowie die Akzeptanz.
- Eine Akteursanalyse sollte vor der Planung durchgeführt werden. Hierfür steht der Leitfaden Akteursbeteiligung der KWW Halle zur Verfügung.
- Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohner:innen müssen ihren Wärmeplan bis zum 30. Juni 2026 vorlegen.
- Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohner:innen haben Zeit bis zum 30. Juni 2028.
- Maßgeblich für die Einordnung ist die Zahl der Einwohner:innen zum Stichtag 1. Januar 2024.
- Für alle Kommunen, die die Kommunale Wärmeplanung nach Kommunalrichtlinie erarbeiten, gilt (zusätzlich zur individuellen Bearbeitungs-/Fertigstellungsfrist aus dem jeweiligen Förderbescheid) die Ausschlussfrist 30.06.2026, da nur dann der Bestandsschutz gemäß § 5 WPG greift.
- Das Konvoi-Verfahren ermöglicht es, dass mehrere planungsverantwortliche Stellen gemeinsam die Wärmeplanung über die entsprechenden Gemeindegebiete ausarbeiten.
- Dies kann zu geringeren Kosten und der gemeinsamen Nutzung von Expertise und Beratungsleistungen führen. Die beteiligten Kommunen haben zudem – insbesondere an den Grenzen der Gemeindegebiete – eine höhere Flexibilität und mehr Möglichkeiten bezüglich der Wärmeplanung.
- Das Konvoi-Verfahren kann zu einem gemeinsamen Wärmeplan führen.
- Das vereinfachte Verfahren ist in § 4 Abs. 3 Satz 1 WPG als Möglichkeit für die Reduzierung des Planungsaufwandes bei der Erstellung der KWP für (Orts-)Gemeindegebiete mit weniger als 10.000 Einwohner:innen beschrieben. Das AGWPG regelt in § 4 Abs. 2 Satz 1 bis 13 diejenigen Punkte, von denen die planungsverantwortliche Stelle absehen kann, um die Wärmeplanung weniger komplex auszugestalten. Es sollte jedoch sorgfältig abgewogen werden, welche Punkte der Vereinfachung für die Kommune sinnvoll sind. Hierzu empfehlen wir folgende Entscheidungshilfe: LINK
- Die verkürzte Wärmeplanung ist in § 14 WPG beschrieben und kann – nach erfolgter „Eignungsprüfung“ – angewendet werden, wenn ein Gebiet voraussichtlich nicht wirtschaftlich an ein Wärme- oder Wasserstoffnetz angeschlossen werden kann. Dann können bestimmte Pflichten entfallen, und das Gebiet kann z. B. als „geeignet zur dezentralen Wärmeversorgung“ dargestellt werden. Eine erneute Prüfung erfolgt alle 5 Jahre.
- Die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung dienen als strategische Entscheidungsgrundlage. Bürger:innen, Unternehmen und weitere Akteure sollen informiert werden, wo künftig bestimmte Wärmeversorgungsarten möglich sind. Der Beschluss des Wärmeplans löst keine Verpflichtungen für die Bürger:innen aus. Die mit der Kommunalen Wärmeplanung erarbeiteten Maßnahmen sollen in den folgenden Jahren umgesetzt werden.
- Die Kommune kann weitere Fördermittel für Umsetzungsprojekte (z. B. Wärmenetze und Machbarkeitsstudien) beantragen, insbesondere über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) oder Programme der KfW.
- Die Kommune kann auf Basis der Kommunalen Wärmeplanung in einem separaten Schritt bestimmte Gebiete offiziell als Ausbaugebiete für Wärmenetze oder Wasserstoffnetze ausweisen. Für diese Gebiete können ab diesem Zeitpunkt bestimmte Verpflichtungen des GEG greifen.
- Der Wärmeplan ist kein einmaliges Produkt, sondern wird regelmäßig alle fünf Jahre überprüft und fortgeschrieben, um neue Erkenntnisse und Entwicklungen zu berücksichtigen.
- Heiße, „klassische“ Wärmenetze: Gedämmte Rohrleitungen, Vorlauftemperatur > 65°C. Es wird eine Übergabestation im Heizungskeller benötigt.
Dabei wird die Bezeichnung „Nahwärme“ oder „Fernwärme“ verwendet, wobei es hierbei technisch keine grundsätzlichen Unterschiede gibt. - Kalte Wärmenetze: Ungedämmte Rohrleitungen, Vorlauftemperatur: <30° C, Wärmepumpe wird in jedem Haus benötigt. Wärmequelle meist Erdreich; unter Umständen ist ein sommerliches Temperieren der angeschlossenen Gebäude mittels des Heizsystems möglich.
- Eine hohe Bebauungsdichte ist ein Hinweis auf einen hohen Wärmebedarf pro Fläche, was für einen wirtschaftlichen Betrieb von Wärmenetzen wichtig ist.
- Ankerkunden (z. B. Industrie, Gewerbe, aber auch größere öffentliche Liegenschaften) sind wichtig, um ein Netz rentabel betreiben zu können.
- Altstadtgebiete mit sehr enger Bebauung könnten aus Platz-/Schallschutzgründen und wegen Abstandsregelungen ungeeignet für dezentrale Lösungen (hier: Luft-/Wasser-Wärmepumpe) sein. Hier käme ggf. ein Nahwärmenetz in Frage.
- Eine zerstreute Siedlung ohne Agglomeration bedeutet lange Leitungswege, was die anteiligen Wärmeverluste im Wärmenetz erhöht. Dies ist daher eher ungeeignet für (heiße) Wärmenetze.
- Eine sehr steile Topologie und eine ungünstige Bodenbeschaffenheit setzen höhere Anforderungen an den Leitungsbau eines Wärmenetzes und verursachen höhere Kosten.
- Straßensanierung und Wärmenetzausbau kombinieren
Eine gute Abstimmung einzelner Gewerke sowie mit der Verwaltung kann zeitliche und finanzielle Synergien bringen. Der zeitgleiche Ausbau von Wärmenetzen und die Umsetzung von Straßenbauprojekten sowie die Nutzung der offenen Trassen zur Mitverlegung von Leitungen (z. B. Wärme, Glasfaser, Strom) verteilt entstehende Kosten auf mehrere Anbieter und reduziert Eingriffe. - Einbindung in Quartierssanierungen
Eine Kombination mit umfangreichen energetischen Gebäudesanierungen oder Modernisierungen von Stadtteilen kann zu sinkendem Wärmebedarf und geringerem Leitungsquerschnitt und geringeren Wärmequellen-Anforderungen führen. - Integration in städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Frühzeitige Wärme-/Netz-Planung in Neubaugebieten oder Konversionsflächen (z. B. alte Kasernen, Industrieflächen). - Kooperation mit Verkehrsprojekten
Zeitgleiche Umsetzung von Wärmeleitungen bei Neubau / Umbau von ÖPNV- oder Radverkehrsinfrastruktur.
- Die Konnexitätszahlungen des Landes Rheinland-Pfalz an die Kommunen sind im Landesgesetz zur Ausführung des Wärmeplanungsgesetzes (AGWPG) in § 6 (Mehrbelastungsausgleich) und die Finanzierung des Wissensaufbaus in § 7 (für planungsverantwortliche Stellen, deren Wärmeplan dem Bestandsschutz unterliegt) beschrieben.
- Es gilt das Konnexitätsprinzip: Die planungsverantwortlichen Stellen erhalten Ausgleichszahlungen vom Land, da diese die Pflicht zur Durchführung einer Kommunalen Wärmeplanung auferlegt bekommen haben.
- Kommunen, die ihre Kommunale Wärmeplanung nach der Kommunalrichtlinie erstellt haben und Bestandsschutz genießen, haben nach § 7 Abs. 1 AGWPG zusätzlich Anspruch auf einen einmaligen Betrag in Höhe von 15.290,00 € für den Wissensaufbau.
- Die Antragstellung für die Auszahlungen erfolgt über das Portal „EF RLP“ des Landes Rheinland-Pfalz.
KfW 261 / 264 – Kommunale Infrastruktur – Energieeffizienz und Umwelt
Zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen für Infrastrukturprojekte wie Nahwärmenetze
KfW 270 – Erneuerbare Energien – Standard
Finanzierung von Anlagen zur Wärmeerzeugung, z. B. Solarthermie oder Biomasse für das Netz
- BAFA - Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)
Neubau von Wärmenetzen mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien:
Modul I: Transformationspläne und Machbarkeitsstudien (bis zu 50 % Förderung)
Modul II: Errichtung von hocheffizienten Wärmenetzen (bis 40 % Förderung)
Modul III: Einzelmaßnahmen zur Dekarbonisierung bestehender Netze (z. B. Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse)
Modul IV: Innovationsförderung (z. B. kalte Nahwärme, intelligente Steuerung)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Errichtung eines Gebäudenetzes sowie Anschluss an ein Gebäude- bzw. Wärmenetz.
- Landesprogramm Zukunftsfähige Energieinfrasturktur ZEIS
Gefördert werden u. a. der Bau / Ausbau von Wärmenetzen (Förderprogramm „ZEIS-Wärme“) und Durchführbarkeitsstudien (Förderprogramm „ZEIS-Durchführbarkeitsstudie“).
- Förderkompass der Energieagentur Rheinland-Pfalz
Listet eine Vielzahl von verfügbaren Förderprogrammen sowohl für Kommunen als auch für Privatpersonen auf.
- Die Auswahl der Organisations- bzw. Gesellschaftsform bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune. Alle Betreibertypen haben ihre jeweiligen Stärken. Um die geeignete Form zu finden, müssen die individuellen Gegebenheiten vor Ort geprüft und eine Strategie für die Aufgabenverteilung einer Projektgesellschaft festgelegt werden.
- Betrieb durch die Kommune und ihre Unternehmen
Z. B. Regiebetriebe, Eigenbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts (AöR), Kapitalgesellschaften mit kommunalen Akteuren als Gesellschaftern. - Kooperation mit privaten Partnern
Private Unternehmen bauen und betreiben das Netz, Kommune stellt Flächen zur Verfügung und / oder leistet eine Anschubförderung. Aber auch Kapitalgesellschaften mit privatwirtschaftlichen (Energieversorgungs-) Unternehmen als Gesellschaftern sind als Betreiber möglich. - Genossenschaftsmodell
Bürger:innen oder lokale Unternehmen beteiligen sich als Eigentümer z. B. im Rahmen einer Energiegenossenschaft, hier sind hohe Akzeptanz und regionale Wertschöpfung zu erwarten.
Es werden ausschließlich bereits vorhandene Daten verwendet. Diese liegen bei öffentlichen Stellen, Behörden, Energieversorgern und Schornsteinfegern vor oder sind in öffentlich zugänglichen Registern und Datenbanken enthalten. Die planungsverantwortlichen Stellen können diese Daten abrufen oder erheben.
Die Daten geben der planungsverantwortlichen Stelle einen Überblick darüber, wie die Wärmeversorgung in ihrem Gebiet zum aktuellen Zeitpunkt organisiert ist und welche Potenziale zur Energieeinsparung sowie an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme vorhanden sind. Auf Grundlage dieser Daten wird gemeinsam mit den relevanten Akteuren eine zukunftsfähige Wärmeversorgung für das betrachtete Gebiet diskutiert und im Wärmeplan dargestellt.
Die erhobenen Daten unterliegen der Datenschutzgrundverordnung. Für die Wärmeplanung werden Energieverbrauchsdaten, Bedarfsabschätzungen sowie Informationen zu bestehenden Wärmeerzeugern, Gebäuden und Energieinfrastrukturen benötigt. Falls jedoch ein Personenbezug möglich wäre, werden die Daten nur in aggregierter Form erhoben.
Auch wenn in den an die Wärmeplanung anschließenden Planungsebenen (z. B. Quartiers- oder Netzplanung) in der Regel zusätzliche und / oder detailliertere Daten erhoben werden müssen, sollten hierbei grundsätzlich auch die im Rahmen der Wärmeplanung erhobenen Daten herangezogen werden. Dies ist wichtig, um Digitalisierung und Effizienz zu steigern und die Wiederverwendung bereits erhobener Daten zu fördern. Bereits bei der Bestandsanalyse in der kommunalen Wärmeplanung sollten Kommunen, Energieversorger und deren Dienstleister daher die Weiterverwendung erhobener Daten berücksichtigen. Hierfür empfehlen sich neben gängigen Dokumenten wie PDF oder Excel vor allem GIS-Dateiformate, die in entsprechende IT-Systeme eingebunden werden können (zum Beispiel Shapefile, Geo.json, GeoPackages etc.).
Die Energieagentur RLP unterstützt mit Erstinformation, Leitfäden und Handreichungen bei der Datenerhebung im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. Außerdem bieten wir einen Datenservice für bestimmte Themenfelder im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung an. Kontaktieren Sie dazu das Referat Klimaschutzmonitoring.
- Kommunale Wärmeplanung
Weitergehende Informationen auf der Seite des Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
- KWP-Landingpage der KWW Halle
Informationen zum Einstieg und zur Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung, aufbereitet in Text- und Videoform.
- Ferner stehen zahlreiche Leitfäden zur Verfügung, die genutzt werden können:
Leitfaden Wärmeplanung der KWW Halle
Leitfaden Akteursbeteiligung der KWW Halle
Meister-Leistungsverzeichnisse der KWW Halle
- Die Energieagentur Rheinland-Pfalz bietet Kommunen eine kostenfreie Beratung rund um das Thema der Kommunalen Wärmeplanung an.
- Die Verbraucherzentrale bietet Bürger:innen Beratung zu den Themen Kommunale Wärmeplanung und individuelle Heizungsanlagen an.
FAQs zum Wärmeplanungsgesetz
Ansprechpartner
Kom. Wärmeplanung
Ich unterstütze Sie, wenn Sie eine Frage zur Kommunalen Wärmeplanung haben.

Nils Füllenbach,
M. Sc.
Referent Kommunale Wärmeplanung
Tel: 0631 34371 197
E-Mail schreiben
Wir beraten Sie gerne
Ansprechpartner
Kom. Wärmeplanung
Ich unterstütze Sie, wenn Sie eine Frage zur Kommunalen Wärmeplanung haben.

Stefan Müller,
Dipl.-Ing. (FH)
Referent Kommunale Wärmeplanung
Tel: 0631 34371 117
E-Mail schreiben
Ansprechpartner
Kom. Wärmeplanung
Ich unterstütze Sie, wenn Sie eine Frage zur Kommunalen Wärmeplanung haben.

Nils Füllenbach,
M. Sc.
Referent Kommunale Wärmeplanung
Tel: 0631 34371 197
E-Mail schreiben
Kommunale Wärmeplanung nach Kommunalrichtlinie
Wir stellen Ihnen Muster-Dokumente für die Ausschreibung und die Vergabe von Leistungen an einen externen Dienstleister zur Verfügung, wenn Sie die kommunale Wärmeplanung nach der Kommunalrichtlinie angehen.
Eine Antragsstellung von Fördermitteln im Rahmen der Kommunalrichtlinie ist nicht mehr möglich, denn die Förderung von Kommunalen Wärmeplänen in der Kommunalrichtlinie ist mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes zum 1.1.2024 ausgelaufen. Auf der Internetseite zur Kommunalrichtlinie ist der Förderschwerpunkt „Kommunale Wärmeplanung“ (Nr. 4.1.11) nicht mehr aufgelistet.

Ihre Ansprechpartner:innen zum Thema Förderung

Wir unterstützen Sie bei Fragen rund um das Thema kommunale Wärmeplanung und Wärmeversorgung.
Sie erreichen uns telefonisch Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.30 Uhr unter 0631 34371 777
Gerne können Sie uns auch per E-Mail Ihre Anfrage senden: foerderung@energieagentur.rlp.de
Was ist die Kommunale Wärmeplanung (KWP)?
Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) ist ein wichtiges Werkzeug für Städte und Gemeinden. Sie hilft dabei, die Wärmeversorgung vor Ort klimafreundlich zu gestalten.
Das Ziel: Eine Wärmeversorgung, die kaum noch CO₂ ausstößt – also möglichst klimaneutral ist. Damit leistet die KWP auch einen Beitrag zur sicheren Energieversorgung und verringert die Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem Ausland.
Mit der KWP können Kommunen einen Plan entwickeln:
- Wo wird wie viel Wärme gebraucht?
- Wie kann diese Wärme umweltfreundlich bereitgestellt werden?
Die Kommunen bekommen damit eine klare Übersicht und können gezielt Maßnahmen umsetzen – zum Beispiel den Ausbau von Wärmenetzen oder den Einsatz erneuerbarer Energien.
Wichtig:
Die Kommunale Wärmeplanung ist kein Bauplan für ein Wärmenetz. Sie zeigt die strategische Richtung, während ein Wärmenetzplan die konkrete Umsetzung beschreibt – also z. B. wo Leitungen verlegt werden.

Kommunale Wärmeplanung und Energieeffizienz: neu gedacht
In diesem Video geben wir einen ersten Überblick darüber, was die Ziele (und die Grenzen) der kommunalen Wärmeplanung sind, welche Verfahrensschritte auf die Kommunen zukommen, und worauf Sie sich als Kommune auf dem Weg zur Energie- und Wärmewende einstimmen können.
Das Video ist noch deaktiviert, damit keine Daten an YouTube übertragen werden. Wenn Sie den Button „Video ansehen“ klicken, dann werden Informationen an YouTube übermittelt. Wir können keine Auskunft über die Art, den Umfang oder den Verwendungszweck der übertragenen Daten geben.
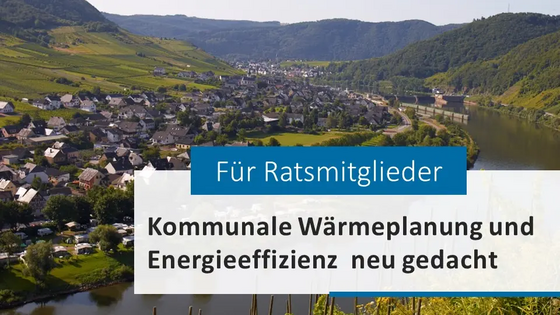
In diesem Video geben wir einen ersten Überblick darüber, was die Ziele (und die Grenzen) der kommunalen Wärmeplanung sind, welche Verfahrensschritte auf die Kommunen zukommen, und worauf Sie sich als Kommune auf dem Weg zur Energie- und Wärmewende einstimmen können.
Kommunale Wärmeplanung in Rheinland-Pfalz

Bisher konnten Kommunen freiwillig eine Kommunale Wärmeplanung (KWP) erstellen – gefördert durch die Kommunalrichtlinie.
Seit dem 01.01.2024 gilt das Wärmeplanungsgesetz des Bundes. Es verpflichtet die Bundesländer, eigene Regelungen zur Wärmeplanung einzuführen. In Rheinland-Pfalz ist das entsprechende Landesgesetz am 26.04.2025 in Kraft getreten.
Damit wird die Kommunale Wärmeplanung für viele Kommunen zur Pflicht – und zu einem wichtigen Baustein für eine klimafreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung.
Wir helfen Kommunen dabei, ihre Wärmeplanung umzusetzen – Schritt für Schritt und gemeinsam mit den Menschen vor Ort.

