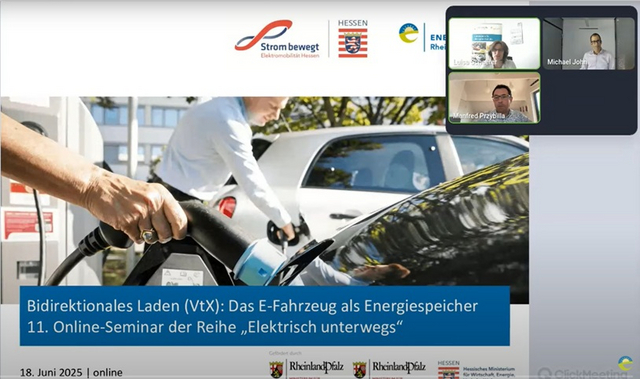In der inzwischen 11. Veranstaltung der Reihe "Elektrisch unterwegs" der rheinland-pfälzischen und hessischen Energieagenturen ging es um das bidirektionale Laden (VtX). Wie sinnvoll ist der Einsatz von E-Fahrzeugen als Speicher im Stromnetz, welche Vorteile für die Fahrzeugnutzenden bringt es mit sich und wie ist der Status quo in der praktischen Umsetzung?
Sektorenkopplung am Beispiel der Elektromobilität
Zu Beginn der Veranstaltung gab Christian Synwoldt, Referent bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz, einen kurzen Überblick über das Thema. Als mobile Speicher können E-Autos einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten, in dem sie die sogenannte Sektorenkopplung ermöglichen. In diesem Fall werden der Strom- und der Mobilitätssektor miteinander "gekoppelt". So kann die Stromerzeugung der erneuerbaren Energien auch für den Verkehr genutzt werden, der zumindest auf der Straße heute noch fast ausschließlich von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Die größte Herausforderung dabei: Im Stromnetz müssen Bedarf und Erzeugung zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen sein. Da die erneuerbaren Energien aber nicht stetig, sondern je nach Wetterlage Strom liefern, brauchen wir zwingend Speicher. Fossile Brennstoffe haben diese Speicherfunktion über ein Jahrhundert lang erfüllt - jetzt braucht es neue Lösungen.
Neben den stationären Speichern, deren Kapazitäten rasant zugenommen haben in den letzten Jahren, sehen wir auch einen deutlichen Anstieg von batterieelektrischen Pkw. Etwa 100 Gigawattstunden Speicherkapazität, verteilt auf ca. zwei Millionen Fahrzeuge, rollt aktuell über Deutschlands Straßen. Natürlich können diese nicht einfach komplett als Speicher zur Netzstabilisierung genutzt werden, denn ihr Hauptzweck ist der Transport von Personen oder Gütern. Dennoch ergeben sich nicht unerhebliche Kapazitäten für die Stabilisierung des Netzes, sobald die Fahrzeuge ans Netz angeschlossen sind. Allerdings müssen die technischen Voraussetzungen sowohl beim Fahrzeug als auch beim Netzanschluss (mit intelligentem Messsystem) gegeben sein.
Berichte aus Feldversuchen von Volkswagen und Ambibox
Aus der praktischen Anwendung in Feldversuchen berichteten anschließend Dr. Andreas Lassota, Business Owner Charging & Energy Volkswagen AG, und Manfred Przybilla, CEO der Ambibox GmbH aus Mainz. Die beiden Unternehmen kooperieren bei der Entwicklung von bidirektionalem Laden und haben aktuell in Schweden ein gemeinsames Projekt am Laufen.
Seit Frühjahr 2023 sind alle Volkswagen ID-Modelle prinzipiell in der Lage, bidirektional zu laden. Dabei wird im Szenario des netzdienlichen Ladens das Haus "zwischengeschaltet"; d.h. eine direkte Steuerung des Fahrzeugs aus dem Netz heraus ist nicht möglich, aber das Auto kann Strom ins Haus liefern und das Haus wiederum ins Netz. E-Fahrzeuge, die per se in der Unterhaltung schon günstiger sind als Verbrenner, können so einen weiteren finanziellen Benefit generieren, nämlich Erlöse aus Energiedienstleistungen. In Deutschland rechnet Volkswagen, basierend auf den Strompreisen aus 2023, mit Umsatzpotenzialen von 380 bis 600 Euro pro Fahrzeug, dies in Abhängigkeit von der Nutzung und dem Ort des Ladens.
Wie dies in der Praxis aussehen kann, testet Volkswagen aktuell in Stenberg in Schweden. Dort wird in einem Mehrparteienhaus auf dem Gelände einer ehemaligen Farm die Sektorenkopplung in einem komplexem System abgebildet, das Energieerzeugung, -optimierung und -speicherung, Mobilitätsanwendung und Wärmeversorgung umfasst. Gesteuert wird das Ganze von einer Energy Bank, die je nach Verfügbarkeit lokal erzeugten PV-Strom nutzt oder auch preissensibel Energie einkauft. Acht “bidi”-fähige Volkswagen ID.4 stehen dort zur Verfügung, und diese laden und speisen ein je nach Bedarf. Dabei kann vorkonfiguriert werden, dass ein gewisser Ladestand in der Traktionsbatterie nicht unterschritten wird.
Die Wallboxen für das Projekt wurden von Ambibox installiert. Ambibox ist ein junges Unternehmen aus Mainz, das mit wissenschaftlicher Expertise Lösungen für Batteriespeichersysteme und bidirektionale DC-Ladetechniken entwickelt. In etwa 50 Pilotprojekten werden die Entwicklungen in der Praxis getestet, dies mit unterschiedlichen Partnern wie zum Beispiel Volkswagen. Ambibox-CEO Manfred Przybilla erläuterte in seinem Vortrag, wie komplex der europäische Strommarkt heutzutage ist, welche Herausforderungen sich durch die Integration der erneuerbaren Energien ergeben und was dies für das bidirektionale Laden bedeutet. Um netzdienliche Stromverbräuche zu fördern, sind wirtschaftliche Anreize für die Frequenzstabilitätsleistungen besonders wichtig. Fällt die Frequenz im Netz, wird die Rückspeisung vom Fahrzeug in die Wallbox, das Haus und schließlich das Stromnetz innerhalb von 100 Millisekunden initiiert.
Nächster Schritt: Markteinführung
In den Feldversuchen in Schweden und auch in Deutschland nehmen E-Autos mit Ambibox-Wallboxen bereits real am Markt teil und kreieren Erlöse. Für 2035 rechnet Ambibox damit, dass E-Fahrzeuge etwa zwei- bis dreimal so viel Speicherkapazität zur Verfügung stellen können, als im Netz benötigt wird. Allerdings müssen dafür nun die Feldversuche hochskaliert werden auf millionenfache Anwendungen im Markt. Die Wallboxen von Ambibox sind zwar serienreif, werden aber vor dem Markteintritt im Herbst 2025 noch intensiven Tests unterzogen. Volkswagen rechnet mit einer breiteren Anwendung durch Nutzende in etwa drei Jahren - zuerst im DC-Bereich, da die Regularien für bidirektionales AC-Laden noch nicht soweit fortgeschritten sind.
Weitere Detailinformationen zum Thema gibt es in der Aufzeichnung der Online-Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Grundlegende Informationen zum Thema “Bidirektionales Laden” finden Sie auf unserer Themenseite.